Die heutige FDP verwaltet, statt zu gestalten. Will sie wieder Erfolg haben, sollte sie aufhören, die Signale ihrer schrumpfenden Wählerschaft zu ignorieren.
Die FDP Schweiz war einst eine «Gründerin»; eine politische Organisation mit enormer unternehmerischer und politischer Kraft, und sie hatte, wie sich das für Gründer gehört, auch eine Idee. Sie hatte eine Vorstellung von einem modernen, liberalen und föderalistischen Staat, in dem Freiheit, Demokratie und Eigenverantwortung sowie das Miliz- und Subsidiaritätsprinzip das staatspolitische Programm bestimmen sollten.
Ein Land als quasi selbstverwaltete Genossenschaft also. Was man ohne Staat regeln konnte, wurde ohne Staat geregelt. Unermüdlich setzten sich die führenden Köpfe dieser Zeit für dieses liberale Modell ein. Der Unternehmer war nicht nur Fabrikant, sondern auch Patron, Offizier, Ständerat, Wohnungsbauer, Kultur- und Bildungsförderer, Vereinsmitglied. Mit viel Fleiss und Engagement schufen diese Leute das Fundament für unseren heutigen Wohlstand. Viele von ihnen – allerdings nicht alle – waren freisinnig.
Heute ist die FDP keine Wohlstandserschafferin mehr, sondern eine Wohlstandsverwalterin. Sie ist nicht die einzige Partei, auf die das zutrifft. Aber bei der FDP ist dieser Wandel besonders schmerzhaft. Die einstige «Gründerin» ist heute eine Getriebene. Statt eigene Ideen zu entwickeln und selbstbewusst zu vertreten, arrangiert sie sich mal mit rechts, mal mit links und vergeudet so ihre Zeit mit «unfreisinnigen» Themen wie Vaterschaftsurlaub oder Kita-Subventionen. Die freisinnige Antwort auf diese beiden Themen wäre übrigens: Das ist Sache der Sozialpartner, nicht des Staates, schon gar nicht des Bundes.
Die FDP ignoriert die Signale ihrer schrumpfenden Wählerschaft seit Jahrzehnten mit erstaunlicher Nonchalance. Das könnte man als Hochmut auslegen. Und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Was die FDP jetzt braucht, wenn sie überleben will, ist Demut, um aus der Talfahrt ehrliche Lehren zu ziehen – und Mut, um frische Ideen im Sinne des liberalen Erbes zu entwickeln.
Zum Niedergang freisinnigen Denkens haben neben der FDP auch Wirtschaftsverbände beigetragen, die sich vom politischen Tagesgeschäft verabschiedet und vom Volk entfremdet haben und nur noch ihre Eigeninteressen bewirtschaften. Wir und insbesondere der Freisinn brauchen ihn wieder: den Typus des sympathischen, volkstümlichen Wirtschaftsführers von ehedem, der sich neben dem Geschäft auch redlich um Gemeinwohl und Gemeinsinn kümmert.
Claudia Wirz ist freie Journalistin und Buchautorin.
Dieser Text erschien zuerst im Schweizer Monat im Rahmen der «FDP-Debatte». schweizermonat.ch
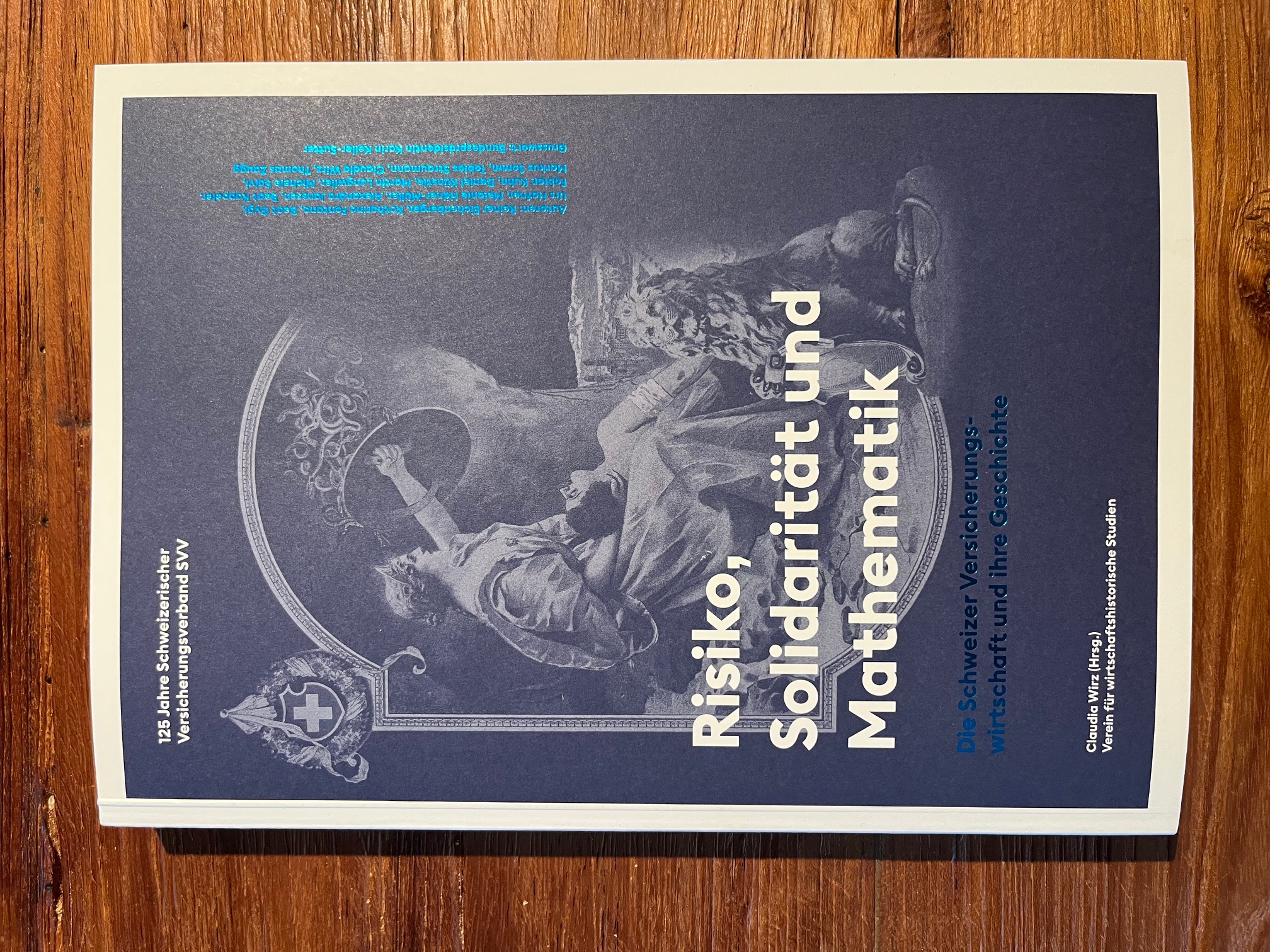
 Zwetschgen sind jetzt Saison!
Zwetschgen sind jetzt Saison!