Die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau ist erreicht. Die Gleichstellungsbeauftragten müssen trotzdem nicht um ihre Arbeitsplätze bangen. Denn nach der rechtlichen steht jetzt die «tatsächliche» Gleichstellung auf dem Programm und das gibt Arbeitsplatzgarantie bis zu Sankt Nimmerlein.
All die staatlichen Gleichstellungsbeauftragten arbeiten in ihren Büros seit vielen Jahren fleissig an der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber was, wenn die Gleichberechtigung vollendet ist? Werden sie dann arbeitslos? Die Frage ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn es gibt seit 2021 einen offiziellen Bericht, der beweist, dass Frauen und Männer in der Schweiz juristisch gleichbehandelt werden.
Oder anders gesagt: Ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen von Männern und Frauen sind ausgeräumt. Und wo sie doch noch vorkommen, gehen sie keineswegs nur zu Lasten der angeblich stets diskriminierten Frauen, im Gegenteil. Man denke etwa an die Militärdienstpflicht mitsamt der Wehrpflichtersatzabgabe.
Kurzum: Männer und Frauen sind von wenigen Ausnahmen abgesehen in der Schweiz gleichgestellt. Von einer systematischen Benachteiligung der Frauen kann schon gar keine Rede sein.
Das offenbart sich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Lebenswirklichkeit. Frauen machen heute zum Beispiel häufiger die Matura als Männer. Und über fehlende weibliche Vorbilder – früher ein gerne bemühter Topos der Gleichstellungslobby – kann heute niemand mehr klagen. Vielmehr werden wir heute überall mit glorifizierter «Frauenpower» torpediert.
Fernsehkrimis sind ohne «starke» Kommissarinnen nicht mehr denkbar, Nachrichtensendungen achten peinlich genau auf die Einhaltung von Frauenquoten bei den Auskunftspersonen, an Radio und Fernsehen wird «gegendert», was das Zeug hält, und in der Welt des Business sind Geschichten über «Powerfrauen» mittlerweile zu einem eigenen Genre geworden.
Die Mission Gleichstellung ist also erfüllt, nein, übererfüllt. Wäre man tatsächlich liberal, wäre es nun höchste Zeit, die erwachsene und gleichgestellte Frau endlich von der staatlichen Übermutter zu entwöhnen. Lasst uns die Gleichstellungsbüros schliessen!
Doch der Staat lässt seine stattliche Schar von Gleichstellungsbeauftragten nicht im Stich. Jetzt wird die «tatsächliche» Gleichstellung gefördert. Gemeint ist damit nichts anderes als die Hebung des Frauenanteils in den Teppichetagen. Die Gleisbaustelle, auf der nachts bei Wind und Wetter und bei eisiger Kälte gearbeitet wird, steht nicht im Fokus dieser Strategie, obwohl dort die Männer stärker dominieren als in der klimatisierten Chefetage.
Heute geht es bei der Gleichstellungspolitik nur noch um zwei Dinge: um die Erschleichung von Privilegien für einige wenige Frauen, die später als gefeierte «Powerfrauen» auf dem Chefsessel sitzen, und um Arbeitsbeschaffung für die Gleichstellungsbüros. Deshalb darf aus der Sicht der Gleichstellungslobby Gleichstellung nie erreicht sein, trotz der jahrzehntelangen steuerfinanzierten Knochenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten.
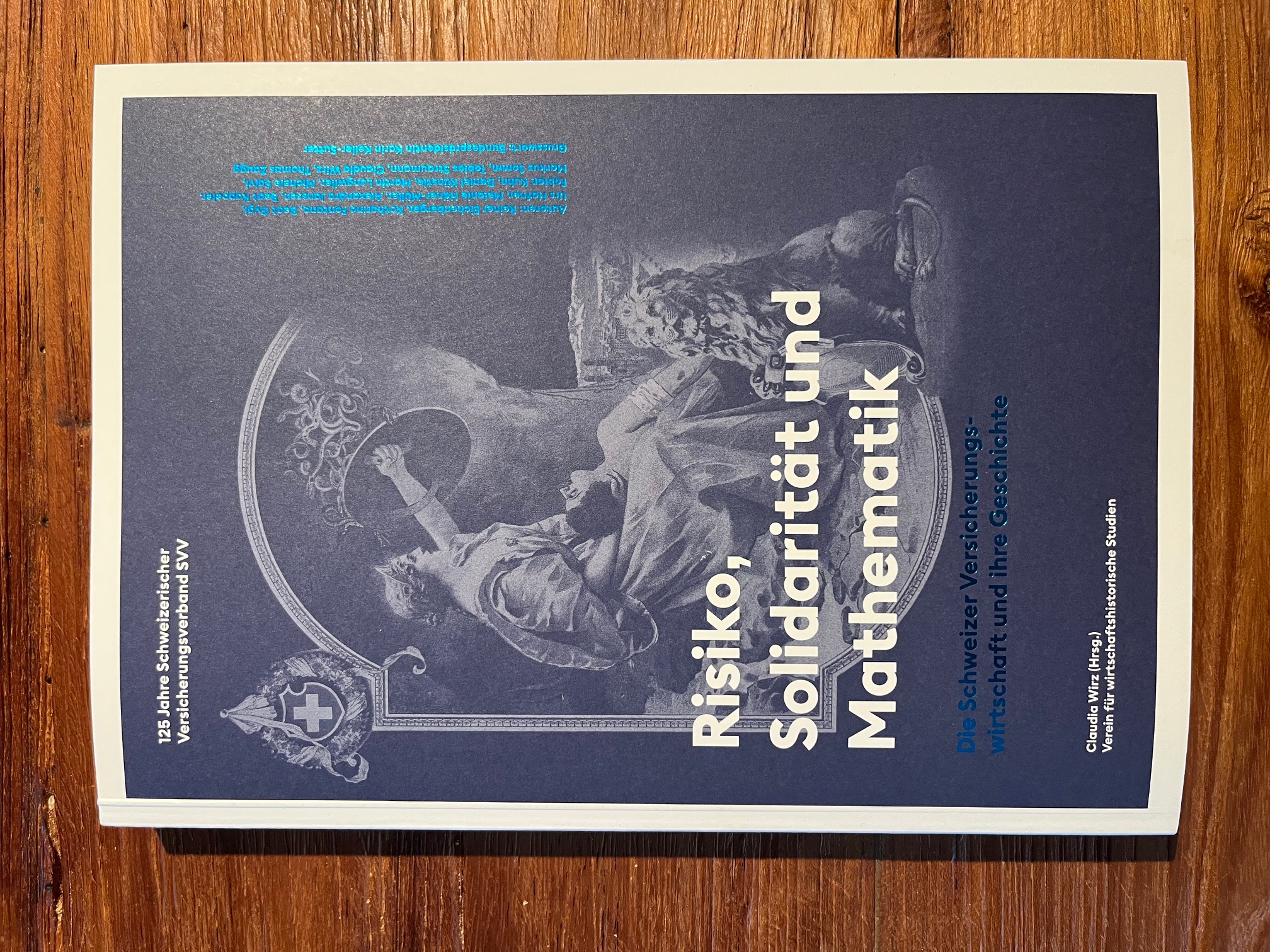
 Zwetschgen sind jetzt Saison!
Zwetschgen sind jetzt Saison! Sommerlicher Ausflug ins Unterengadin (bei Schuls).
Sommerlicher Ausflug ins Unterengadin (bei Schuls).